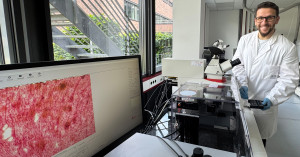Dortmund, 16. September 2022
Es ist längst kein Geheimnis mehr, dass Frauen und Männer während eines Herzinfarkts unterschiedliche Symptome zeigen. Ebenfalls steht fest, dass unerwünschte Arzneimittelwirkungen bei Frauen fast doppelt so häufig auftreten wie bei Männern. Allerdings ist die Rolle des Geschlechts als biologischer Faktor bei der Entstehung unerwünschter Arzneimittelwirkungen kaum verstanden. Fakt ist auch: Es gibt einen signifikanten Geschlechtsunterschied in der Expression eines Gens, das für den Arzneimittelstoffwechsel wichtig ist.
Was bedeuten geschlechterspezifische Unterschiede generell für die Gesundheitsforschung? Welche Rolle spielen sie in der angewandten Grundlagenforschung, etwa für das Verständnis zur Genese von Erkrankungen oder bei der Suche nach neuen Therapieansätzen? Die Redaktion hat fünf ISAS-Wissenschaftler:innen gebeten, sich zu geschlechterspezifischen Aspekten in ihren Forschungsfeldern zu äußern.

Es ist bekannt, dass einige Medikamente bei Frauen und Männern anders wirken. Dies hat beispielsweise mit geschlechterspezifischen Unterschieden hinsichtlich der Arzneimittelaufnahme, -verteilung und -effekte zu tun. Bei der Übertragung von Forschungsergebnissen in die Praxis muss man daher anstreben, männliche und weibliche Proband:innen bzw. Patient:innen gleichwertig in die Studien einzuschließen.
In meiner Arbeitsgruppe setzen wir ganz am Anfang an, bei der Genese von Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Sobald wir den Krankheitsmechanismus identifiziert haben, geht es zuerst darum, eine sogenannte Targetingstrategie bzw. therapeutische Strategie zu entwickeln. Je nach Fragestellung untersuchen wir diese in der Regel zunächst an einem Geschlecht, bevor wir die Untersuchungen ausweiten.
Prof. Dr. Kristina Lorenz Direktorin Translationale Forschung Leiterin Kardiovaskuläre Pharmakologie

Künstliche Intelligenz könnte in der Lage sein, bei der Auswertung mikroskopischer Aufnahmen einen Geschlechtsunterschied zu erkennen, wenn ein solcher Unterschied etwa aus pathologischer Sicht besteht. So könnten bestimmte Gewebe von männlichen Spendern unter dem Mikroskop anders aussehen als von weiblichen. KI kann die Bilder vergleichen und zum Beispiel Unterschiede in der Größe von Drüsen in weiblichem und männlichem Gewebe erkennen.
Dr. Jianxu Chen Leiter AMBIOM – Analysis of Microscopic BIOMedical Images

Eine geschlechterspezifische massenspektrometrische Analyse von Proteinen ist für unsere Suche nach Biomarkern zum Verlauf und zur Therapiekontrolle bei neuromuskulären Erkrankungen (NME) wichtig. Trotz vieler Gemeinsamkeiten auf biologischer Ebene bei Frau und Mann gibt es einige Unterschiede, die bei der Suche nach Biomarkern entscheidend sein können. So unterscheiden sich bei Frau und Mann nicht nur die Sexualhormone, sondern zum Beispiel auch die Aktivität des serotonergen Systems, das an der Regulation fast aller Hirnfunktionen beteiligt ist, oder der Spiegel des Stresshormons Cortisol im Speichel.
Auch einige neuromuskuläre Erkrankungen sind bei den Geschlechtern verschieden ausgeprägt. So sind beispielsweise fast ausschließlich Männer von der Erbkrankheit Muskeldystrophie Typ Duchenne betroffen.
Der Grund dafür ist, dass Frauen mit dem mutierten Gen auf einem X-Chromosom diesen genetischen Fehler mit ihrem zweiten X-Chromosom kompensieren können. Eine geschlechterspezifische Analyse ist für die Biomarker-Suche bei einigen neuromuskulären Erkrankungen sinnvoll, schränkt aber gleichzeitig die Probenmenge ein – gerade bei seltenen Erkrankungen stellt uns die geringe Zahl an Patient:innen vor Herausforderungen.
Dr. Andreas Hentschel Mitarbeiter Translationale Analytik

Die rheumatoide Arthritis (RA) betrifft mit rund 75 Prozent der Patient:innen vornehmlich Frauen. Folglich spielen insbesondere die weiblichen Sexualhormone wie Östrogen und Progesteron eine wichtige Rolle bei der Entstehung dieser Autoimmunerkrankung. Bei den meisten Patientinnen tritt die RA in der Menopause, also unter Progesteron- und Östrogenmangel, auf. Dementsprechend zeigen auch verschiedene Studien positive Effekte von Hormonersatztherapien bei Frauen mit postmenopausaler RA. Die RA ist allerdings keine ausschließliche Frauenkrankheit – etwa ein Viertel der Betroffenen ist männlich. Die Forschung hat gezeigt, dass RA bei Männern mit niedrigen Blutwerten für Testosteron assoziiert ist. Testosteron hat immunregulierende und entzündungshemmende Funktionen. Somit scheinen auch männliche Geschlechtshormone einen wichtigen Einfluss auf die Entstehung von RA zu haben.
Bei unserer Arbeit berücksichtigen wir diese geschlechtsspezifischen Unterschiede und fokussieren uns zur Erforschung der RA bei unseren Tiermodellen primär auf weibliche Mäuse. Um den Geschlechtereinfluss bei der Entstehung der Erkrankung näher bewerten zu können, vergleichen wir anschließend zusätzlich die Befunde der weiblichen Mäuse mit denen männlicher Tiere. Auch bei der Analyse von humanen Proben schließen wir sowohl weibliche als auch männliche Patient:innen in unsere Studien ein.
Prof. Dr. Anika Grüneboom Leiterin Bioimaging

Es stimmt, dass das Geschlecht die Entwicklung von neurodegenerativen Erkrankungen beeinflusst. Eine der »einfachen« Erklärungen dafür, warum Frauen eher zu Alzheimer neigen, liegt darin, dass Frauen im Durchschnitt fünf Jahre länger leben als Männer. Alter ist der Hauptrisikofaktor für die Entwicklung von Alzheimer. Außerdem sind Frauen anfälliger für Autoimmunkrankheiten, und diese Entzündungsprozesse könnten ein Auslöser für die Plaquebildung sein. Was Morbus Parkinson betrifft, haben Männer zwar eine anderthalb- bis zweifach höhere Tendenz, daran zu erkranken. Aber Frauen mit Parkinson haben einen viel schlechteren und schnelleren Krankheitsverlauf. Die Gründe dafür sind nach wie vor unklar. Die Berücksichtigung beider Geschlechter bei der Durchführung von Experimenten wird in der Forschung zunehmend geschätzt, insbesondere von Wissenschaftler:innen, die das Altern und altersbedingte Erkrankungen untersuchen.
Auch wenn diese Aspekte wegen der physiologischen Unterschiede zwischen den Geschlechtern nicht immer einfach zu interpretieren und zu analysieren sind, können sie doch einen Schlüssel zum Verständnis der Entwicklung dieser Prozesse auf molekularer Ebene liefern und hoffentlich zur Entwicklung gezielter Arzneimittel führen.
Dr. habil. Miloš Filipović Leiter ERC-Sulfaging