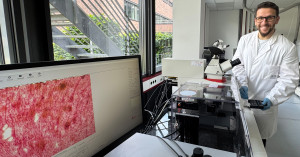Dortmund, 8. September 2025
Susmita Ghosh ist Doktorandin in der Arbeitsgruppe Biofluoreszenz und eine der drei Erstautor:innen einer Studie im Journal of Neuroinflammation. Gemeinsam mit Ali Ata Tuz (ISAS und Universitätsklinikum Essen) und Laura Karsch (Universitätsklinikum Essen) hat sie den Zusammenhang zwischen Darmmikrobiota und Neutrophilen Granulozyten untersucht. Im Interview spricht die Biologin über ihre Forschung zu Proteinen und den Effekt, den Neutrophile nach einem Schlaganfall auf das Gehirn haben.

Susmita Ghosh analysiert Proben von neutrophilen Granulozyten am ultrasensitiven Massenspektrometer. So möchte sie untersuchen, wie sich die Immunzellen nach einem Schlaganfall verhalten.
© ISAS / Hannes Woidich
1. Wie seid ihr auf den Zusammenhang zwischen Darmmikrobiota, der Aktivierung von Neutrophilen und Schlaganfällen gestoßen?
Ghosh: In unseren vorherigen Studien konnten wir beobachten, dass aktivierte Neutrophile einen negativen Einfluss auf die Folgen eines Schlaganfalls haben. Wir wollten herausfinden, warum das so ist, und die entscheidenden Faktoren identifizieren. Währenddessen untersuchte Dr. Vikramjeet Singh vom Universitätsklinikum Essen den Zusammenhang zwischen Darmmikrobiota und dem Verlauf von Schlaganfällen. Gemeinsam wollten wir herausfinden, ob die Darmmikrobiota bei einem Schlaganfall die Aktivierung von Neutrophilen auslösen können. Dazu haben Ali Tuz, Laura Karsch und ich die Bereiche der Studie gleichmäßig aufgeteilt. Während Ali und Laura ihr Fachwissen in den Bereichen Bildgebung und Durchflusszytometrie einbrachten, war ich für die Proteom-Analysen mittels Flüssigchromatographie-Massenspektrometrie (LC-MS) verantwortlich. Da das Verhalten der Neutrophilen von ihrer Proteinexpression abhängt, entschieden wir uns für die Proteom-Analyse, um zu verstehen, wie diese Immunzellen sich nach einem Schlaganfall verhalten. Aus dem Gehirn von Mäusen mit Schlaganfall konnten wir nur eine Handvoll Neutrophile gewinnen, was für Proteom-Analysen schwierig ist. Da ich den Proteomics-Ansatz für Proben mit geringem Input aber bereits in einer früheren Studie optimiert hatte, war es einfach, diese Methode anzuwenden, um den Einfluss der Darmmikrobiota auf die Neutrophilen zu untersuchen.
2. Was genau haben deine Ergebnisse über die Darmmikrobiota und die Aktivierung von Neutrophilen gezeigt?
Ghosh: Ich habe das Proteom von Neutrophilen analysiert, die aus dem Gehirn und Blut von Mäusen isoliert wurden, die einen Schlaganfall erlitten hatten. Mithilfe der „label-free“ quantitativen Proteomics habe ich die Veränderungen in der Proteinexpression zwischen Neutrophilen nach Mikrobiota-Entfernung mit denen aus der Kontrollprobe, in der Mikrobiota vorhanden waren, verglichen. Daraus konnten wir schließen, dass Neutrophile von Mäusen mit reduzierten Mikrobiota weniger aktiviert waren – und die Reparatur des Hirngewebes nach einem Schlaganfall stärker unterstützten. Diese Erkenntnis deutet darauf hin, dass das Darmmikrobiom die Neutrophilen-Aktivierung nach einem Schlaganfall verstärkt, wodurch mehr Entzündungen entstehen und bestehende verschlimmert werden. Wir konnten meine Ergebnisse mit denen aus anderen Experimenten unter Verwendung von ELISA, Enzyme-linked Immunosorbent Assays validieren. Dies war für uns wichtig, da die Validierung von Proteom-Daten schwierig ist und in Forschungsarbeiten oft fehlt.
Lesetipp
Tuz, A. A., Ghosh, S., Karsch, L., Antler, M., Lakovic, V., Lohmann, S., Lehmann, A. H., Beer, A., Nagel, D., Jung, M., Hörenbaum, N., Kaygusuz, V., Qefalia, A., Alshaar, B., Amookazemi, N., Bolsega, S., Basic, M., Siveke, J. T., Heiles, S., Grüneboom, A., Lueong, S., Herz, J., Sickmann, A., Hagemann, N., Hasenberg, A., Hermann, D. M., Gunzer, M., Singh, V.
(2025) Gut microbiota deficiency reduces neutrophil activation and is protective after ischemic stroke. Journal of Neuroinflammation, 22, Nr. 137.
3. Wie tragen eure Erkenntnisse über die Darmmikrobiota zu unserem Verständnis ihrer Rolle nach einem Schlaganfall bei? Und wie sehen die nächsten Schritte dieser Forschung aus?
Ghosh: Die Darmmikrobiota ist für unser tägliches Leben unverzichtbar. Unsere Ergebnisse deuten jedoch darauf hin, dass eine gesunde Mikrobiota aufgrund aktivierter Neutrophile einen negativen Einfluss auf den Verlauf eines Schlaganfalls haben kann. Wir wissen aber noch nicht, wie diese Wechselwirkung zwischen Mikrobiota und Neutrophilen zustande kommt. Wenn es uns gelingt, die Faktoren zu identifizieren, die die Neutrophilen aktivieren, könnten wir versuchen, sie zu hemmen, um Gewebeschäden zu reduzieren. Allerdings wissen wir auch noch nicht, ob unsere Erkenntnisse auf die menschliche Darmmikrobiota übertragbar sind. Dies ist ein spannendes Forschungsgebiet, in dem noch viele Fragen offen sind.
(Das Interview führte Anna Becker.)