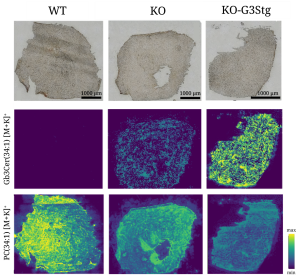Dortmund, 21. Dezember 2023
Der Psychologe Leon Windscheid verkauft für sein Bühnenprogramm „Gute Gefühle“ 100.000 Tickets, die von Mediziner Eckart von Hirschhausen moderierten Wissenschaftssendungen laufen seit Jahren zur Primetime im Fernsehen und die Videos der Chemikerin Mai Thi Nguyen-Kim waren zeitweise die bestgeklicktesten auf Youtube. Alle beweisen: dass Wissenschaft kompliziert und deswegen trocken sein muss, stimmt nicht. Gut gemacht ist Wissenschaftskommunikation Unterhaltung pur. Das wollten auch vier Mitarbeitende des ISAS zeigen und trauten sich zum institutseigenen Science Slam im Dezember auf die Bühne.
„Science Slam bedeutet Wissenschaftskommunikation!“ – mit diesen Worten eröffnete Cheyenne Peters die Veranstaltung am ISAS Campus. Schon im Oktober dieses Jahres hatte die Wissenschaftsredakteurin das Kick-off-Meeting für den Science Slam angesetzt und kurz darauf mit den Trainings für die Forschenden begonnen. „Wie kommuniziere ich Wissenschaft? Wie entwickle ich eine Geschichte? Ich möchte gerade den Nachwuchswissenschaftler:innen Wege aufzeigen, mit denen sie ihre Forschung unkonventionell, locker und für Laien verständlich präsentieren können“, sagt Peters.

Den stolzen Moment nach ihren Slams teilten die vier Teilnehmenden für ein Foto mit Luisa Becher, Autorin dieses Beitrags und Praktikantin im Team Kommunikation am ISAS.
© ISAS
Gute Wissenschaft gelingt durch Teamwork
Die Teilnehmenden stellten sich mit kreativen Beiträgen zu ihrer Forschung oder selbst gewählten Themen dem Publikum. Dafür hatte jede:r zehn Minuten Zeit. Darleen Hüser wagte sich als Erste auf die Bühne. Im Kerzenschein und mit dickem Buch erinnerte die Doktorandin an eine weihnachtliche Geschichtenerzählerin: eines Nachts erwachen im Labor alle Mikroskope und Hilfsmittel wie eine Pipette zum Leben. Im echten Leben forscht Hüser zu molekularen und zellulären Vorgängen, die durch Entzündungen ausgelöst werden. Zur Klärung ihrer immunologischen Fragestellungen nutzt die Biologin verschiedene Analyseverfahren, etwa das Lichtblatt-Fluoreszenzmikroskop oder das Konfokalmikroskop. Mit viel Humor und auf Englisch reimte die Wissenschaftlerin über Fluorophore, den Stokes Shift und die Vorzüge der einzelnen Mikroskopietechniken. Das mit bunten Animationen unterlegte Gedicht machte schnell klar, dass die Stärke der Techniken nicht in ihrer Einzigartigkeit liegt, sondern darin, sie gemeinsam anzuwenden. So quietscht die kleine Pipette im Gedicht vor Freude „with your strengths combined as a team, together you are a microscopic dream.” Und genau das wollte Hüser neben dem wissenschaftlichen Inhalt vermitteln: “Teamwork ist immer der Schlüssel zum Erfolg. Wir haben am ISAS sehr viele unterschiedliche Expertisen und können diese interdisziplinär einsetzen. Das ist unsere methodische und menschliche Stärke!“

Doktorandin Darleen Hüser ließ für ihren Slam in einer Weihnachtsgeschichte Mikroskope und Pipetten im Labor lebendig werden.
© ISAS
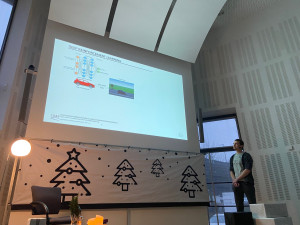
Johann Dierks ist Physiker und promoviert am ISAS zu einem anderen Thema. Aber weil ihn die Einsatzmöglichkeiten von Künstlicher Intelligenz faszinieren, ging es in seinem Slam um die Tücken der KI am Beispiel seines Hobbys: autonom fliegende Drohnen bauen.

Kathrin Krieger forscht zu Haptic gloves. Auch privat ist virtuelle Realität bei der Doktorandin als passionierte Gamerin ein Thema. Was sie dabei erlebt und was das Ganze mit ihrer Forschung zu tun hat, teilte die Bioinformatikerin mit dem Publikum.
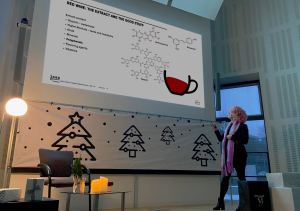
Mit viel Charme, Witz und Fantasie tauchte Luisa Röbisch mit den Anwesenden in die Welt der Northpole University ein. Das Publikum hatte bei ihrem Slam nicht nur ordentlich zu lachen, sondern lernte auch eine Menge über die Bestandteile von Glühwein. Ihre Verzehrsempfehlung für das Heißgetränk versah die Biolaborantin mit einer großen Prise Humor.
Virtuelle Forschung zum Anfassen
Interdisziplinarität und Interesse an verschiedenen Forschungsthemen zeigten sich auch im Vortrag von Johann Dierks. Der Science Slam 2023 bot den Teilnehmenden nämlich auch die Möglichkeit, sich wissenschaftlich mit einem Thema außerhalb des eigenen Forschungsgebiets zu beschäftigen. Dierks begeistert sich für Künstliche Intelligenz (KI). Mit seinem Vater hat der Physiker bereits eine selbstfliegende Drohne gebastelt. Ein Absturz der Drohne brachte ihn auf die Idee für seinen Beitrag beim Science Slam. Dierks stellte sich und dem Publikum unter anderem die Frage, wer zukünftig für von der KI verschuldete Fehler und Unfälle die Verantwortung übernehmen müsse.
Auch Kathrin Krieger konfrontierte das Publikum mit einer computerwissenschaftlichen Fragestellung: Warum braucht es Virtuelle Realität (VR) in einer Forschungseinrichtung wie dem ISAS? Nicht etwa zum Computer spielen, wie die Gaming-begeisterte Forscherin betonte, sondern um Wissenschaft im wahrsten Sinne greifbar zu machen. Krieger arbeitet an Haptic gloves. Diese VR-Handschuhe ermöglichen es Träger:innen, virtuelle Objekte zu berühren – und damit zu begreifen. „Ich finde Wissenschaftskommunikation extrem wichtig. Zum einen, um fachfremden Menschen ein Thema näher zu bringen und sie damit an der Debattenkultur teilhaben zu lassen. Zum anderen aber auch, um uns in interdisziplinären Teams wie hier am ISAS gegenseitig zu bilden“, sagte Krieger. Anschließend ermutigte die Wissenschaftlerin mit zahlreichen Interaktionen und Requisiten das Publikum, die eigene Wahrnehmung auf den Prüfstand zu stellen. Gleichzeitig führte sie den Teilnehmenden vor Augen, welche Vorzüge der Haptic gloves sie nutzen können. So können Forschende beispielsweise 3D-Computermodelle ihrer Mikroskopaufnahmen perspektivisch mittels der Haptic gloves anfassen. Ärzt:innen könnten sich in Zukunft so auf Operationen vorbereiten, indem sie sich in der virtuellen Welt beispielsweise mit dem Gewebe oder den Organen befassen.
„Wissenschaft steckt im Alltäglichen“
Auch Luisa Röbischs Präsentation war ein Plädoyer für mehr Vernetzung und mehr Kommunikation. Die Technische Assistentin hatte sich von ihrem Hobby, dem Theater spielen, inspirieren und zu einem komödiantischen Vortrag motivieren lassen. Das ISAS wurde dabei zur Northpole University, die Mitarbeitenden zu emsigen Elfen und Röbisch selbst zu Dr. Dr. rer. chris. Eugenia F. Stardust. Mit wippenden rosa Locken und glitzernden Wangen erklärte Stardust die chemische Zusammensetzung von Glühwein. „Wissenschaft steckt im Alltäglichen. Man braucht nur neugierig die Umwelt zu beobachten“, kommentierte Röbisch ihre Themenwahl. Positiver Nebeneffekt des von ihr vorgestellten Heißgetränks voller pflanzlicher Sekundärmetabolite: der Genuss erleichtert die Kommunikation. Mit einem Augenzwinkern und dem Appell, sich den ein oder anderen weihnachtlichen Wein schmecken zu lassen, entließ die Biotechnologin das Publikum in die Abstimmung.
99,4 Dezibel für den Sieg
Am Ende des Science Slams war es an den Zuhörenden, ein:e Gewinner:in zu bestimmen. Mittels Dezibelmesser wurde der lauteste Applaus pro Slam ermittelt. Nur wenige, mit den Ohren kaum wahrnehmbare Dezibel machten den Unterschied aus. Darleen Hüser konnte mit ihrem aufwendigen Gedicht und der liebevoll gestalteten Präsentation überzeugen und gewann den ISAS Science Slam 2023. Einen Plan für einen weiteren Science Slam hatte die lachende Gewinnerin sogleich: „Beim nächsten Mal sind die Leiter:innen unserer Forschungsgruppen am Zug.“
(Luisa Becher)
Luisa Becher (30), Mikrobiologin aus dem Rheinland, hat nach ihrem Masterstudium gemerkt, dass sie noch lieber über viele verschiedene Forschungsgebiete berichten will. An der TU Dortmund studiert sie deswegen inzwischen Wissenschaftsjournalismus. Beim Radio Bonn/Rhein Sieg und dem WDR hat sie erste journalistische Gehversuche unternommen. Als Praktikantin im Team Kommunikation am ISAS macht sie sich nun ein Bild davon, wie die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit in einem der Leibniz-Institute funktioniert.