Dortmund, 9. September 2021
Mona Ehlers hat schon früh ihren Forschergeist entdeckt. 2010 zog sie deshalb aus Niedersachsen in ihre Wahlheimat Münster, um dort Lebensmittelchemie zu studieren. Während ihrer Promotion in Berlin nutzte sie Metabolomics-Verfahren, um die verschiedenen Bestandteile von Wein zu analysieren. So konnte sie beispielweise erkennen, ob er gepanscht, also verfälscht, wurde. Da sie mit ihrem Know-how zur Gesundheit des Menschen beitragen möchte, kam sie im Mai 2021 ans ISAS.
Seitdem ist Ehlers Teil der Arbeitsgruppe Proteomics. Die 30-Jährige forscht im Verbundprojekt NephrESA („Modellbasierte Optimierung der Anämiebehandlung für den einzelnen Patienten mit chronischer Nierenerkrankung“) daran, die Behandlung von Blutarmut (Anämie) bei chronisch nierenkranken Patient:innen zukünftig verbessern zu können.
Omics-Technologien – das große Ganze sehen
Aufgrund der chronischen Erkrankung produzieren die Nieren vieler Patient:innen keine ausreichende Menge des Hormons Erythropoietin (Epo) für die normale Blutbildung. Zur Therapie dieser renalen Anämie erhalten sie Epo oder andere sogenannte Erythropoese-Stimulatoren (ESA). Ehlers beschäftigt sich mit dem stark erhöhten Thromboserisiko, das bei dieser medikamentösen Behandlung häufig auftritt. Sie arbeitet an einer Analysemethode, mit der sie erkennen kann, welche Proteine sich in diesem Fall im Blut verändern. So könnten zukünftig die Risiken und Prognosen der Medikation bei den Betroffenen individuell ermittelt werden. Für ihre Methode nutzt die Forscherin sogenannte Omics-Technologien. Sie zeichnen sich durch einen kombinierenden Ansatz aus, der es ermöglicht, die Daten mehrerer molekularer Ebenen zu erfassen und ein ganzheitliches Bild einer Probe abzubilden. „Die Analysen ähneln dem, was ich vorher gemacht habe. Nur untersuche ich jetzt Blutplasma, statt Rotwein“, sagt Ehlers. Rund 300 Patientenproben, bereitgestellt vom Projektpartner Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf (UKE), warten dafür bereits bei minus 80 Grad Celsius am ISAS darauf, untersucht zu werden. Anhand der Daten will die Chemikerin weiter herausfinden, wie das erhöhte Thromboserisiko frühzeitig zu erkennen und zu behandeln ist.
Bisher nur digital
Die insgesamt fünf Projektpartner von NephrESA haben sich zwar jeweils auf einen Bereich spezialisiert, tauschen sich aber regelmäßig über ihre Erkenntnisse aus. „Aufgrund der Pandemie geht das natürlich bisher nur digital oder per Telefon. Das ist manchmal schwierig, da wir uns die Abläufe im Labor nicht gegenseitig zeigen können“, berichtet Ehlers. Deswegen freut sie sich darauf, die anderen Projektpartner:innen sobald wie möglich persönlich treffen zu können. Nach der Pandemie möchte sie auch wieder zwei ihrer Hobbies nachgehen, die sie zuletzt in der Hauptstadt ausüben konnte: Im Chor singen und Lindy Hop tanzen.
(Cheyenne Peters)
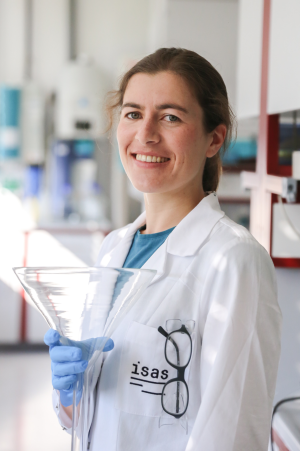
Mona Ehlers forscht am ISAS daran, die Behandlung von Blutarmut bei chronisch nierenkranken Patient:innen zu verbessern.
© ISAS
Was sind Omics Technologien?
Mit dem Begriff Omics bezeichnet die Forschung molekularbiologische Methoden, beispielweise Genomics, Lipidomics, Metabolomics oder Proteomics, mit denen sich Biomoleküle aus Gewebeproben oder anderen biologischen Proben auf globaler Ebene untersuchen lassen. Omics-Technologien sind ein wichtiger Ansatzpunkt in der personalisierten Medizin, da sie große Datenmengen produzieren, die Aufschluss über Krankheitsvorgänge und mögliche Therapieansätze liefern.








