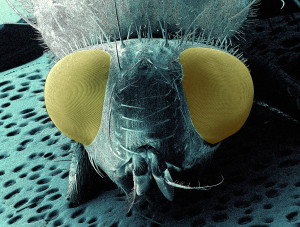Dortmund, 14. Februar 2020
Iodidsalze als Schlüssel zum nachhaltigen Erfolg biologischer Katalysatoren in Brennstoffzellen? Der massenhafte Einsatz von Brennstoffzellen könnte Großkraftwerke und Hochspannungsleitungen überflüssig machen, Autos abgasfrei fahren lassen und Hausbesitzer zu ihren eigenen Stromproduzenten werden lassen. Aber: Die eine Art von Katalysatoren – Edelmetalle wie Platin – sind sehr teuer und die Ressourcen werden immer kleiner. Die zweite Art von Katalysatoren wäre im Überfluss vorhanden: nämlich biologische und bio-inspirierte Katalysatoren. Trotzdem werden diese natürlichen Katalysatoren bisher kaum für Energieumwandlungsprozesse eingesetzt. Denn diese Katalysatoren sind mitunter so empfindlich gegenüber Sauerstoff, dass sie binnen weniger Sekunden ihre Funktion einstellen.
Was dagegen tun? Damit setzte sich ein Forschungsteam um Prof. Dr. Nicolas Plumeré von der Ruhr-Universität Bochum (RUB), Dr. Erik Freier und Dr. Ute Münchberg vom Leibniz-Institut für Analytische Wissenschaften Dortmund (ISAS) sowie Prof. Dr. Wolfgang Lubitz vom Max-Planck-Institut für chemische Energieumwandlung im Mülheim auseinander. Es berichtet in der renommierten Zeitschrift Nature Communications vom 14. Februar 2020: „Iodidsalze machen Biokatalysatoren für Brennstoffzellen stabil.“

Unendlicher Schutz – bisher nur in der Theorie
Vor kurzem hatte die Arbeitsgruppe entdeckt, dass redoxaktive Filme bioinspirierte und sogar Biokatalysatoren wie Hydrogenasen vor Sauerstoff schützen können. Theoretische Modelle sagen voraus, dass der Schutz vor Sauerstoff unendlich lange anhalten sollte. In Experimenten wirkt dieser Schutz jedoch bisher nur wenige Stunden. „Das steht im Widerspruch zu unseren theoretischen Berechnungen und lässt sich auch angesichts der Lebensdauer desselben Katalysators in einer sauerstofffreien Umgebung nicht erklären“, so Plumeré. Letztere beträgt bei konstantem Umsatz bis zu sechs Wochen.
Kombination von Methoden geht dem Problem auf den Grund
Die Forscher:innen schlossen daraus, dass entweder der Mechanismus für den Schutz vor Sauerstoff noch nicht verstanden ist, oder dass neben der Deaktivierung durch Sauerstoff zusätzliche schädliche Prozesse stattfinden. Um dem nachzugehen, kombinierten sie verschiedene Methoden, die es ihnen erlaubten, genau zu untersuchen, was in der schützenden Schicht passiert. Die Kombination von konfokaler Fluoreszenzmikroskopie und kohärenter Anti-Stokes-Raman-Streuung, die im Labor von Erik Freier am ISAS durchgeführt wurden, mit Elektrochemie für die Analyse der Schutzmatrix zeigten: Der Schutzprozess führt zu einer Ansammlung von Wasserstoffperoxid, die eine Schädigung des katalytischen Films fördert.
Wasserstoffperoxidbildung unterdrücken
Die Arbeiten zeigen, dass die Aufspaltung von Wasserstoffperoxid mithilfe von Jodidsalzen die Halbwertszeit einer Hydrogenase für die Wasserstoffoxidation bei konstantem Umsatz auf bis zu eine Woche erhöht, selbst wenn konstant hohe Sauerstoffkonzentrationen darauf einwirken. „Insgesamt bestätigen unsere Daten die Theorie, dass Redox-Filme sauerstoffempfindliche Katalysatoren völlig immun gegen die direkte Deaktivierung durch Sauerstoff machen“, fasst Plumeré zusammen. „Es ist aber sehr wichtig, auch die Wasserstoffperoxid-Produktion zu unterdrücken, um einen vollständigen Schutz vor oxidativem Stress zu erreichen.“
„Unsere Arbeit zeigt, dass die einfache Strategie der Zugabe von Jodidsalzen zum Elektrolyten ausreichen kann, um die Inaktivierungsraten von Biokatalysatoren deutlich zu senken“, so die Forscher:innen. Das ermöglicht nach ihrer Einschätzung die flächendeckende Umsetzung anderer elektrokatalytischer Prozesse in realen Anwendungen. Dazu gehören auch Energieumwandlungsprozesse wie die solare Brennstofferzeugung durch Kohlendioxidreduktion und die Elektrosynthese von Fein- oder Grundchemikalien wie Ammoniak.
Förderung
Die Arbeiten wurden gefördert von der Deutschen Forschungsgemeinschaft im Rahmen des Exzellenzclusters Ruhr Explores Solvation Resolv (EXC-2033 – Projektnummer 390677874) und des Projekts Shields (PL 746/2-1) und vom European Research Council im Rahmen des Starting Grant 715900. Weitere Unterstützung kam von der Max-Planck-Gesellschaft, vom China Scholarship Council sowie vom Ministerium für Kultur und Wissenschaft des Landes Nordrhein-Westfalen, dem Regierenden Bürgermeister von Berlin – inklusive Wissenschaft und Forschung und vom Bundesministerium für Bildung und Forschung sowie vom Leibniz-Research-Cluster (031A360E).
Originalveröffentlichung
Huaiguang Li, Ute Münchberg, Alaa A. Oughli, Darren Buesen, Wolfgang Lubitz, Erik Freier, Nicolas Plumeré: Suppressing hydrogen peroxide generation to achieve oxygen-insensitivity of a [NiFe] hydrogenase in redox active films, in: Nature Communications 2020, DOI: 10.1038/s41467-020-14673-7
Weiterführende Links
Lesen hier den Artikel zum Thema, der am 14.02.2020 in Nature Communications erschienen ist.
Hier geht es zur Pressemitteilung der RUB.